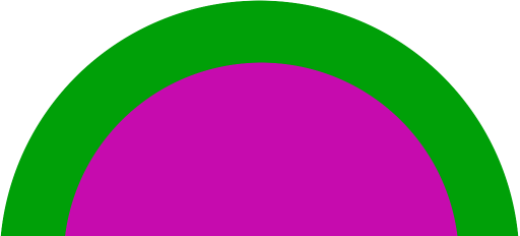Jedes Jahr im Frühjahr ist es wieder soweit: Wir fahren mit dem Auto unseres Weges und wo wir gestern noch mit hundert Stundenkilometern fahren durften, werden wir plötzlich durch zwei Hinweisschilder begrüßt: Eines mit einem Frosch und darunter eines mit einer rot umrandeten 50 auf weißem Grund, die uns beide sagen möchten: Vorsicht Krötenwanderung! Sofort fällt auch der grüne Zaun auf, der einseitig die Straße säumt.
Es ist wieder soweit, die Amphibien machen sich zwischen Anfang März und Ende April auf zur Wanderschaft und müssen dabei einen teils gefährlichen Weg hinter sich bringen, der leider oft genug tödlich auf der Straße endet. Soviel wissen wir alle, aber wie sieht es eigentlich auf der anderen Seite des grünen Zauns aus? Warum sehe ich da nie jemanden wenn ich vorbeifahre? Wieso geht der Graben weiter, aber der Zaun hört einfach auf? Wie vielen Tieren hilft man da überhaupt und findet man noch andere Tiere außer Kröten?
Ich durfte mich in diesem Jahr einer Gruppe von Amphibienrettern anschließen, um mir selbst und euch diese Fragen zu beantworten und hier könnt ihr sie lesen. Holt euch etwas zu trinken, es wird länger.
Ein Zaun muss her!
Es ist Ende Februar, unangenehm kalt und ich stehe an einem Waldweg an einer Bundesstraße. Zum Glück ist die Straße trocken, sonst würden die vorbeifahrenden LKWs die Situation noch unangenehmer machen. Hier treffe ich auf vier Helfer in Warnwesten, die vom Waldweg aus in beide Richtungen den bekannten grünen Zaun aufbauen.
Der Zaun muss nicht nur an Pfosten befestigt werden, sondern die untere Kante muss auch leicht eingegraben werden, damit die Kröten nicht unter dem Zaun hindurch können. Danach müssen noch die Eimer in regelmäßigen Abständen direkt am Zaun eingegraben werden, damit die am Zaun entlang wandernden Kröten in die Eimer fallen, von den HelferInnen eingesammelt und dann über die Straße gebracht werden können. An sich stimmt diese Vorstellung auch, ist aber stark abstrahiert, denn zur Amphibienrettung gehört einiges mehr. Die Helfer erklären mir wie die Krötenrettung abläuft und alles was sie mir jetzt nicht sagen, werde ich in den nächsten Tagen und Wochen lernen.
Da sind zunächst mal unsere Protagonisten, die Amphibien. Das sind nämlich nicht nur Kröten, sondern auch Frösche, Molche und Salamander. Sie alle wollen über die Straße. Neben den HelferInnen vor Ort hat auch die örtliche Untere Naturschutzbehörde ein Interesse am Amphibienschutz, denn das ist Teil ihres Auftrags. Dafür „sponsort“ sie auch den Zaun, die Straßenschilder aus dem Einleitungstext und Baustellenblinklichter, dazu gleich mehr.

Die Krötenretter und die Untere Naturschutzbehörde

Als „Gegenleistung“ erwartet die Behörde aber auch eine Dokumentation der Arbeit der Ehrenamtlichen und zwar mit folgenden Kriterien:
– Sammelort
– Sammelzeit morgens oder abends
– Temperatur zur Sammelzeit
– Witterungsverhältnisse nass/trocken und sonnig/bewölkt
– Tieranzahl von: männlichen Kröten, weiblichen Kröten, Doppeldecker (also weiblichen Kröten mit einem Männchen auf dem Rücken), Frösche und Molche.
Bild: Erdkröten können farblich recht unterschiedlich sein, die Farbe lässt aber nicht auf das Geschlecht schließen.



Brunftschwielen: An den dunklen Stellen an den Händen, vom Daumen aus gesehen, kann man gut die männlichen Kröten erkennen.
Nicht nur Amphibien landen im Eimer, auch Blindschleichen, Mäuse, Spinnen oder wie hier: ein Hainlaufkäfer
Der eigentliche Grund für die Wanderung: Nachwuchs. Gut zu erkennen sind die Laichschnüre.
Warten
Aber wie unterscheidet man denn zwischen Männchen und Weibchen? Die Weibchen sind etwas größer und kräftiger, die Männchen haben zudem noch schwarze Brunftschwielen: Das sind dunkle Verhornungen an den Fingerinnenseiten, mit denen sich das Männchen auf dem Rücken des Weibchens festhält und sich tragen lässt.
Doch bevor das große Dokumentieren losgeht, müssen die Kröten erstmal den Impuls bekommen, ihren Wanderstock in die Hand zu nehmen und loszulaufen. Unser Zaun ist jetzt zwar aufgebaut, doch es ist immer noch zu kalt. Damit die Kröten wandern, sollte es mindestens fünf Grad über Null und am besten auch feucht sein. Da ich recht nah „am Zaun“ wohne, melde ich mich in der WhatsApp-Gruppe als Vorhut, damit die anderen HelferInnen sich nicht umsonst zu der viel längeren Anfahrt aufmachen. Ich bin neu, deshalb liest sich der Chat etwa so:
A: Kann heute jemand schauen, ob es losgeht?
B: Ja, kann ich machen, brauche aber Hilfe wenn es soweit sein sollte.
C: kein Problem, ich bin abrufbereit.
Ich: Ich kann vorbeifahren, auf was muss ich denn achten und wo genau muss ich gucken?
B: Da und da. Das wäre toll. Vergiss Warnweste und Taschenlampe nicht.
Ich: Und wann?
A: In der Dämmerung, so ab halb sieben.
Ich: ok.
B: und nimm einen Eimer mit. Wenn du die erste Kröte siehst, sagst du Bescheid, dann fährt jemand von uns los, wir brauchen ja ein bisschen.
Ich: ok.
A: Normalerweise sieht man es leider schon auf der Straße wenn es losgeht.
Es geht los

Dienstag, 11. März. Da es in den letzten Tagen kalt war, wurden die Eimer mit Deckeln verschlossen. Wenn es kalt ist, wandern die Kröten nicht. Damit dann nicht andere Tiere oder doch mal eine verträumte Kröte in die Eimer fallen und die HelferInnen kontrollieren müssen, verschließt man die Eimer, da keine Tiere zu erwarten sind.
Da es nun wieder wärmer wird und sogar Regen angesagt ist, wurden die Eimer wieder geöffnet. Gegen 20 Uhr mache ich „meine Runde im Graben“, zumal es zu regnen beginnt. Nichts. Ich fahre wieder nach Hause und melde in die WhatsApp-Gruppe, dass alles ruhig ist.
Gegen 21 Uhr fährt nochmal eine Helferin am Graben vorbei und meldet: „Kröten! Es raschelt überall!“
Leider kann ich an diesem Abend selbst nicht mehr mithelfen und somit bleibt mir meine erste Kröte noch vergönnt. Einträge in der WhatsApp-Gruppe „Krötenrettung“ informieren mich dann später, dass an dem Abend noch über 100 Tiere eingesammelt und über die Straße gebracht wurden. Fotos der ersten Kröten werden geteilt. Doch leider gibt es auch Meldungen von einigen toten Tieren, die außerhalb der Zaunreichweite die Straße überqueren wollten. Auch sie werden dokumentiert.
Bild: ein Bergmolchmännchen
Der Eimer ist der Kescher der Krötenretter
Doch das richtige Krötenwanderwetter ließ noch einige Tage auf sich warten und das merkte man auch in der WhatsApp-Gruppe: Wird es heute Abend losgehen? Wie viel Grad sollen es heute Abend werden? Was sagt das Wetterradar? Wer kann gucken gehen? Alle waren etwas unruhig und warteten auf den Startschuss.
Der kam dann auch: Es wurde wärmer, es wurde ein bisschen nass, die ersten Kröten wanderten und bald pendelte sich eine Art „Krötendienst-Alltag“ ein, der in einer zweiten WhatsApp-Gruppe „Kröten – Wer geht?“ in einem kleinen Dienstplan gemanaged wurde. Denn man darf nicht vergessen: Alle die hier helfen, tun dies unentgeltlich in ihrer Freizeit, teils vor und nach der Arbeit. So meldete ich mich z.B. vorrangig für den morgendlichen Einsatz, da ich das gut mit meinem beruflichen Alltag vereinbaren konnte: Morgens zwischen 6:30 Uhr und 8 Uhr öffne ich nun den Absperrzaun zum Waldweg, damit Waldarbeiter in den Wald können und dann laufe ich mit dem Sammeleimer zwischen vier und fünf Kilometer die Eimer ab.
Strecke machen
Obwohl der Zaun vielleicht nur 650 Meter lang ist, in der heißen Wanderphase muss man mehrfach zwischen dem Zaun und dem Teich, zu dem die Kröten wandern wollen, hin und her laufen, denn zum Teil sammeln wir 150 Tiere und mehr an einem Morgen ein! Dazu schaue ich in jeden Eimer, nehme die Kröten vorsichtig heraus und setze sie in meinen Transporteimer. Ich bekomme schnell ein Gespür dafür wann in dem Eimer genug Tiere sitzen um wieder mal den Teich anzusteuern. Erst am Teich werden die Tiere gezählt und in Art und Geschlechter differenziert.
Der Abendtrupp schließt dann wieder mit dem mobilen Zaun die Zufahrt zum Waldweg ab, damit die „Wanderer“ auch bei der Straßeneinfahrt am Zaun entlang zum Eimer geleitet werden. Da abends zwischen 20 und 23 Uhr gesammelt wird, müssen sich die HelferInnen noch mehr schützen, denn längst nicht alle Autofahrer halten sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Dazu werden an den beiden Enden des Zauns an Straßenschildern die blinkenden Baulampen festgeschraubt, so dass die Autofahrer gewarnt sind, dass sie in einen Gefahrenbereich fahren, bzw. ihn wieder verlassen.
Wie weit sollte man eingreifen und von wie vielen Tieren sprechen wir eigentlich?

Ich habe mir natürlich die Frage gestellt, warum man die Tiere nicht nur über die Straße bringt und sie dann in die Wiese setzt, schließlich wären sie alleine auch den ganzen Weg bis zum Teich gelaufen, der etwa 100 Meter von der Straße entfernt hinter einem Feld liegt. Die Antwort ist ganz einfach: Reiher, Füchse, Waschbären und andere Tiere bei denen Amphibien auf dem Speiseplan stehen würden einen gedeckten Tisch vorfinden. Ja klar, diese Tiere wollen auch leben, aber man muss es ihnen ja nicht einfacher machen als nötig.
Außerdem geht es Amphibien durch den Klimawandel und schwindenden Lebensraum zusehends schlechter, sprich, ihre Zahl nimmt ab. Man kann sicherlich darüber streiten, in wie weit man in die Wanderung eingreift. Wir haben jedenfalls bis zum Teich Krötentaxi gespielt und es war immer wieder ein schönes Erlebnis zu sehen, wie Erdkrötenweibchen und Erdkrötenmännchen in ihrer etwas plumpen Art Richtung Wasser gingen, um dort dann wesentlich eleganter durch das kalte Nass zu schwimmen.
Wieder erwische ich mich dabei, wie ich die ganze Zeit nur von Kröten schreibe. Dabei geht es auch um andere Amphibien, allerdings in unverhältnismäßig kleinerer Anzahl: Sprechen wir bei den Kröten von dreistelligen Zahlen pro Tag, so sind es z.B. bei den Bergmolchen selten zehn, eher fünf und bei den Fröschen noch mal entsprechend weniger, vielleicht drei pro Saison. Auch Teichmolche wurden wenig gefunden. Umso faszinierender sind sie natürlich anzuschauen, ist einem der Anblick der Kröten doch zu schnell vertraut. Doch auch sie bekommen Aufmerksamkeit und ist es ihnen zu wenig, so sagt einem das zurückhaltende Quaken aus dem Sammeleimer: Ich bin noch da.


Zu den Bildern: nicht nur Amphibien landen landen in den Eimern, sondern aus Versehen auch Käfer, Spinnen, Blindschleichen und wie hier: Zauneidechsen. Sie wollen im Wald bleiben.
Sicher ist sicher
Dort wo Amphibien auf Wanderschaft gehen und eine Straße die Route durchkreuzt, gelten zum Glück meist Geschwindigkeitsbegrenzungen. Diese gelten natürlich nicht nur wegen der Tiere, sondern auch für die Helfer, die im Dunkeln die Straße queren müssen. Doch Kröte & Co stirbt nicht nur durch das bloße Überfahren, manchmal reicht auch ein krasser Druckwechsel: Das nahende Auto schiebt einen Überdruck vor sich her, befindet sich dann irgendwann über oder neben der Kröte und dort herrscht ein Unterdruck. Dieser Wechsel von Über- zu Unterdruck kann zum Platzen der Organe führen, weshalb ein noch langsameres Fahren besser wäre.


Salamander haben wir bis jetzt gar nicht gefunden, aber geben soll es hier welche. Sie sind auch der Grund, weshalb wir mit Nitrilhandschuhen arbeiten und nach getaner Arbeit unsere Schuhe desinfizieren müssen, zumindest wenn wir an verschiedenen Sammelorten arbeiten. Denn Batrachochytrium salamandrivorans, kurz Bsal, setzt den Tieren zu. Bsal ist ein eingeschleppter Chytridpilz aus Asien und führt bei Schwanzlurchen zu Hautläsionen an denen sie verenden. Damit sich die Salamanderpest genannte Krankheit möglichst nicht weiter verbreitet sind diese Maßnahmen notwendig.
Kinder finden das Retten der Kröten natürlich auch spannend und wollen helfen, jedoch ist die Aktion nur bedingt für sie geeignet: In den Morgenstunden wäre das Sammeln eigentlich kein Problem, doch genau wie in den Abendstunden (teils länger als 23 Uhr) ist natürlich der Straßenwechsel an einer Bundesstraße sehr gefährlich, Blinklichter hin oder her.
Wie geht es weiter?
Jetzt haben wir Anfang April, die Saison befindet sich in ihrer Mitte und zudem wollen die Tiere, die den Weg zum Teich auf sich genommen haben, bald auch alle wieder zurück. Warum berichte ich dann jetzt schon? Ganz einfach: Wenn ihr auch Spaß daran habt oder euch einfach vorstellen könnt, den Tieren zu helfen, in Verbindung mit ein bisschen Citizen Science und ihr seht Amphibienhelfer am Zaun, dann sprecht sie an. Denkt nicht, dass es ja schon genug Helfer gibt, davon kann es nicht genug geben, denn mal kann der eine, mal die andere. Aber mal eben auch nicht und dann kannst du helfen!
Neben dem Krötenretten, nein – Amphibienretten, tust du auch etwas für dich, nicht nur körperlich sondern auch für die Seele und nicht zuletzt lernst du tolle Menschen kennen.
Bild: Eine Erdkröte sitzt im Schilf neben Ballen von Froschlaich

Ich bin übrigens über die Igel-Nothilfe zu den Krötenrettern gestoßen. Wie ich Igel auswildere habe ich hier beschrieben. Du kannst z.B. auch beim NABU nachfragen, evtl. gibt es bei dir eine Ortsgruppe.
Im letzten Jahr wurden an der Stelle, an der ich seit diesem Jahr mithelfe, übrigens über 3000 Tiere sicher zu ihrem Laichplatz gebracht.
Ich bin gespannt, wie viele es dieses Jahr werden.
Und nächstes Jahr. Denn dann werde ich auch wieder helfen.
An dieser Stelle möchte ich noch danke sagen. Danke, dass ich so freundlich in die Gruppe der Krötenretter aufgenommen wurde und ich in kurzer Zeit viel von euch lernen durfte. Danke an: Sonja, Bettina, Julia, Susanne, Heike, Miriam, Isolde, Nicki, Lea, Jule, Oliver, Flo & Elena.
Alle Bilder sind in dieser Krötensaison entstanden. Doch nicht alle habe ich geschossen, einige sind von den anderen Krötenrettern und wurden mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Auch dafür: Vielen Dank.